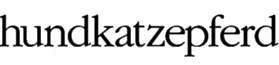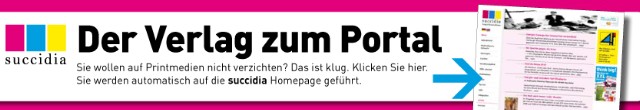|
Was tun??
Was tun??Sehnenschaden – Neue Behandlungsstrategien Von PD. Dr. Georg Rindermann, PD Dr. Bianca Carstanjen (Ph. D.)Sehnenschäden stellen beim Sportpferd eine bedeutende Lahmheitsursache dar. Risse bzw. Erkrankungen der oberflächlichen Beugesehne sind für annähernd 46 % der Lahmheiten beim Rennpferd verantwortlich[1]. Ursache ist, dass Sehnengewebe über eine eingeschränkte Dehnbarkeit verfügt. Je nach Stärke der Krafteinwirkung auf die Sehne wird sie zuerst reversibel, dann irreversibel gedehnt. Die Diagnostik von Sehnenerkrankungen stützt sich auf die klinische Untersuchung sowie bildgebende Verfahren. Zahlreiche Therapieansätze wurden in der Vergangenheit hervorgebracht, jedoch waren die Effekte hinsichtlich einer signifikanten Verbesserung der klinischen Symptomatik, Wiederherstellung des Sehnengewebes und Verkürzung der Rekonvaleszenzperiode oftmals enttäuschend. Pathogenese
Als Mechanismen der Sehnenschädigung sind mechanische Einflüsse in Form kumulativer Mikroläsionen, Temperaturschädigung durch Reibungswärme während der Belastung und eine relative Sauerstoffarmut im Sehnengewebe durch kompressive Kräfte, die durch Dehnung entstehen, zu nennen. Letztgenannte führt zusätzlich zur Entstehung von Gewebedefekten (Reperfusionsschäden) durch Freisetzung toxischer Radikale. Sehnenbioptate von Pferden mit Sehnenerkrankungen zeigen ein erhöhtes Vorkommen von gewebeabbauenden Substanzen (Cytokinen), insbesondere von Tumornekrosefaktor alpha (TNF) und Interleukin-1 (IL-1) [3]. Diese bewirken eine erhöhte Aktivität von Enzymen wie zum Beispiel der Matrixmetalloproteasen (MMP`s) und Cyclooxygenase 2 (COX-2), welche zerstörend auf die Sehnengrundsubstanz und Sehnenzellen wirken. Therapie
Herkömmliche Therapiemethoden beinhalten die Verwendung von polysulfatierten Glycosaminoglycanen, Hyaluronsäure, die an oder in den Defekt injiziert wird, lokalen Behandlungen, Verbänden, Laser, Ultraschall sowie die Verwendung von Stoßwellentherapie. Seit geraumer Zeit hat das Interesse an regenerativen Strategien zur Behandlung von Sehnen- und Bänderschäden stark zugenommen. Diese regenerative Medizin macht sich die körpereigenen Substanzen und Botenstoffe des Pferdes zur gezielten Therapie zunutze.
Eine weitere Möglichkeit besteht in der Verwendung von plättchenreichem Plasma (PRP). Diese Plättchenkonzentrate sind durch eine mindestens vierfache Erhöhung der Thrombozytenkonzentration im Vergleich zum Vollblut charakterisiert. Sie sind eine autologe Quelle für zahlreiche Wachstumsfaktoren, insbesondere für „transforming growth factor ?“ (TGF ?1 und 2), „insulin-like growth factor“ (IGF-1), „platelet derived growth factor“ (PDGF), „vascular endothelial growth factor“ (VEGF) [6]. Die Wirkungsmechanismen von plättchenreichem Plasma sind vielfältiger Natur; so kommt es durch TGF ?? zu einer Niederregulation von gewebeabbauenden Zytokinen, durch VEGF wird unter anderem die Bildung von Decorin angeregt, einem kleinen Proteoglycan, welches an der Organisation des Kollagenfibrillendurchmessers und für elektrostatische Vernetzungen verantwortlich ist, also entscheidend zu Festigkeit und Organisation im Sehnengewebe beiträgt. Des Weiteren wird die Bildung von Kollagen Typ I bewirkt sowie die Bildung von „cartilage oligomeric matrix protein“ (COMP), welches als „Katalysator“ der Kollagenfibrillogenese angesehen werden kann. Es fördert die Organisation der Kollagenmatrix durch seine Bindung an Kollagen Typ I [7]. Negative Effekte, wie etwa die Aktivierung von MMP`s, konnten durch verschiedene Studien nicht nachgewiesen werden [8]. Nachsorge Unabhängig vom Therapieansatz kommt es auf ein differenziertes Patientenmanagement an. In der akuten Phase ist dies v. a. die Gewährleistung der notwendigen Boxenruhe, die durch den Pferdebesitzer konsequent eingehalten werden muss sowie unterstützende Maßnahmen (z. B. der Einsatz von antiphlogistischen Einreibungen und Kühlung) und ggf. das Anbringen eines orthopädischen Beschlages. In der Umbauphase, die erst Monate nach Auftreten der Läsion vorkommt, kommt es zu einer (zumindest teilweisen) Konversion von Typ III-Kollagen zu Typ I-Kollagen. Kontrollierte Bewegung kann ab diesem Zeitpunkt entscheidend dazu beitragen, diese Umbauvorgänge zu beschleunigen, vor allem jedoch die Anordnung der Fasern in ihrer Zugrichtung auszubilden, wodurch die mechanischen Eigenschaften der Sehne verbessert werden. Entscheidend für diese Patientenüberwachung sind gewissenhafte und regelmäßige sonographische Verlaufskontrollen, um so den Sehnenaufbau optimal zu unterstützen. Nur auf diese Weise können die Zeitpunkte der zu Anfang notwendigen Boxenruhe und dem folgenden Aufbauprogramm sicher bestimmt werden. Literatur beim Autor Foto: picture-alliance / dpa
C arstanjen.Bianca@vetmed.fu-berlin.de |
HKP 3 / 2009
Das komplette Heft zum kostenlosen Download finden Sie hier: zum Download Die Autoren:Weitere Artikel online lesen |
|||
|
||||
Suche: