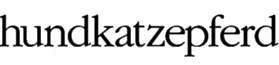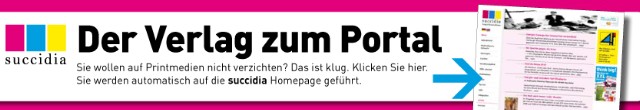|
Nieren kaputt - und nun ?
Nieren kaputt - und nun ?
Urämie ist ein häufiges Symptom, besonders bei Notfallpatienten. Etwa 1/4 der Hunde und 1/8 der Katzen mit Urämien leiden an potenziell reversiblen akuten Nierenschädigungen. Je nach Ursache können bis zu 80 % der Tiere mit akuten Nierenschäden erfolgreich therapiert werden. Dr. René Dörfelt erörtert diagnostische Maßnahmen und Therapieoptionen inklusive Blutreinigungsverfahren für Patienten mit akuten Nierenschädigungen.
Pathophysiologie akuter Nierenschädigungen

Akute Nierenschädigungen (engl. acute kidney injury (AKI)) sind durch einen plötzlichen, potenziell reversiblen Abfall der exkretorischen Funktion der Nieren gekennzeichnet. Die Pathogenese setzt sich zusammen aus vaskulären, tubulären und zellulären Abweichungen. In der nur einige Stunden andauernden Initialphase werden die Nieren dem schädigenden Insult ausgesetzt. Durch das Zusammenspiel neuronaler und humoraler Faktoren kommt es zu Hypoperfusion, Vasokonstriktion, tubulärem Rückfluss, Obstruktion der Tubuli, Ischämie, ATP-Mangel, zellulärem Kalziumeinstrom und weiterer Zellzerstörung. Während der Reperfusion werden Sauerstoffradikale freigesetzt, die zu weiterer Zellzerstörung führen. In der Tage bis Wochen andauernden Erhaltungsphase kommt es zur Ausprägung der Urämiesymptome wie Mattigkeit, Erbrechen und Anorexie, Polyurie, Oligurie oder Anurie. Die bis zu einigen Monaten anhaltende Heilungsphase ist durch Zellteilung, Entfernung der Obstruktion und langsame Wiederkehr der Nierenfunktion gekennzeichnet.
Diagnostik der akuten Nierenschädigung
Die Diagnose akuter Nierenschädigungen beruht auf Anamnese, klinischer Untersuchung, Labordiagnostik, bildgebender Diagnostik und histologischer Untersuchung.
Der erste Schritt – Vorbericht und klinische Untersuchung
Die Anamnese gibt erste Hinweise zum Ursache. Eine kurze Dauer der klinischen Symptome wie Lethargie, Anorexie und Vomitus von unter einer Woche ist hinweisend für eine akute Nierenschädigung. Bei längerer Symptomdauer mit Polydipsie/Polyurie und Gewichtsverlust ist ein chronischer Prozess wahrscheinlicher. Der Kontakt zu Chemikalien, toxischen Pflanzen und kranken Tieren sollte ebenso erfragt werden wie der Impfstatus, Traumata, diagnostische Tests, Medikamente und Anästhesien. Bei Patienten mit schweren Azotämien sollte bei der klinischen Untersuchung besonders auf Hydratationsstatus, kardiovaskuläres System, Palpation des Abdomens und der Nieren geachtet werden. Des Weiteren ist auf Ernährungszustand, Haarkleid, Temperatur, Ulzera auf Maulschleimhaut und Zunge, Schleimhautfarbe, Tach- ypnoe, Urinfarbe und Dysurie zu achten. Bei Normothermie oder Hyperthermie sind infektiöse oder neoplastische Ursachen des Nierenversagens wahrscheinlich.
Die Laboruntersuchung – Erkennung weiterer Abweichungen
Bei vermutetem Nierenversagen ist eine ausführliche Labordiagnostik notwendig. Es sollte ein rotes und weißes Blutbild, eine klinisch chemische Untersuchung, eine Bestimmung der Elektrolyte und eine Urinanalyse beinhalten. Eine normochrome, nicht regenerative Anämie wird oft bei chronischen Nierenerkrankungen (engl. Chronic kidney disease (CKD)) beobachtet, kann aber auch bei AKI vorkommen. Eine Leukozytose wird oft bei infektiöser AKI beobachtet. Eine normale Leukozytenzahl ist dennoch kein Parameter zum Ausschluss von Infektionen. Eine Thrombozytopenie wird häufig bei Leptospireninfektionen und Neoplasien beobachtet. Hohe Harnstoffwerte bei moderaten Kreatininwerten weisen auf prärenale Prozesse wie Dehydratation, kardiale Grunderkrankungen, Morbus Addison oder gastrointestinale Blutungen hin. Bei urämischen Patienten ist das Phosphat häufig erhöht. Die Leberenzyme und Bilirubin sind zum Teil bei Vomitus und bei AKI aufgrund einer Leptospirose erhöht. Bei Hyperkaliämie sollte an Oligurie, Anurie, postrenale Urämie und Hypoadrenokortizismus gedacht werden.
Bei Hyperkalzämie können primärer Hyperparathyreoidismus oder ein paraneoplastisches Syndrom Ursache der AKI sein.
Urin gibt viele Informationen
Im Rahmen der Urinuntersuchung werden zuerst Farbe und Geruch, gefolgt von spezifischem Gewicht, Stick und Sediment beurteilt. Bei anurischer oder oligurischer AKI ist gelegentlich stechend stinkender, dunkler Urin zu finden. Bei polyurischen Erkrankungen ist der Urin häufig hell und klar. Bei Tieren mit AKI wird oft eine Isosthenurie, aber auch häufig ein USG von 1012- 1020 g/L beobachtet. Eine Glukosurie ohne erhöhten Blutglukosespiegel ist verdächtig für einen Tubulusschaden. Dieser ist oft bei AKI aber auch gelegentlich beim CKD vorhanden. Die meisten urämischen Tiere weisen eine Proteinurie auf. Zur Spezifizierung ist die Urinprotein Urinkreatinin Ratio (UP/UC) hilfreich. Das Urinsediment sollte auf Erythrozyten, Leukozyten, Bakterien, Zylinder und Kristalle untersucht werden. Erhöhte Erytrozytenkonzentrationen sind bei Infektionen, Neoplasien und Traumata vorhanden. Eine erhöhte Leukozytenzahl und/oder Bakterien im Zystozentheseharn weist auf Harnwegsinfektionen hin. Zur Diagnose eine Bakteriurie sind ein gefärbter Urinsedimentausstriches und eine Urinkultur hilfreich. Bei 11 – 33 % der Hunde mit AKI und ca. 8 % der Hunde mit CKD sind im Sediment Zylinder vorhanden. Das Vorhandensein von Kalziumoxalatkristallen kann auf eine Ethylenglykolintoxikation hinweisen.
Spezialuntersuchungen
Jeder Hund mit AKI sollte auf Leptospirose getestet werden. Dies ist mit einem Serumtiterpaar im Abstand von 2 – 4 Wochen und einer Urin- PCR möglich. Bei Ethylenglykolintoxikationen sind oft hohe Serumosmolalität, hohes Anion Gap, metabolische Azidose und Kalziumoxalaturie auffällig. Ethylenglykol und seine Metaboliten im Blut können in kommerziellen Labors nachgewiesen werden.
Bildgebende Diagnostik
Eine Röntgenuntersuchung des Abdomens ermöglicht eine generelle Beurteilung der Nierengröße und gibt einen Überblick über die Bauchorgane. Mithilfe von Kontrastuntersuchungen können postrenale Ursachen wie Obstruktionen dargestellt werden. Beim der AKI ist die Ultraschalluntersuchung der Nieren meist ohne pathologische Befunde. Gelegentlich sind die Nieren vergrößert, es besteht ein Kapselödem oder die Nierenrinde ist ggr. Verdickt und hyperechogen. Bei chronischen Veränderungen sind häufig kleine, grobhöckrige Nieren mit hyperechogener Rinde und verwaschener Rinden-Mark.-Grenze auffällig. Mithilfe von Doppleruntersuchungen kann der intrarenale Blutfluss beurteilt werden. Dies hilft, die AKI von CKD abzugrenzen. Außerdem kann zur Differenzierung eine Ultraschalluntersuchung der Parathyreoidea erfolgen. Zur Diagnose in schwierigen Fällen eignet sich die Untersuchung von Nierenbiopsien. Dies ist sinnvoll, wenn das Ergebnis einen Einfluss auf die Prognose oder die Therapie hat.
Medikamentöse Therapie der AKI
Falls die Ursache der Urämie bekannt ist, sollte diese spezifisch therapiert werden. Die Grundlage der symptomatischen Therapie stellt die gezielte intravenöse Infusionstherapie dar. Flüssigkeitsdefizite sollten innerhalb von 2 – 6 h ausgeglichen werden. Darauf folgend werden der Erhaltungsbedarf und zusätzliche Verlust über Vomitus oder Polyurie infundiert. Bei anurischen/oligurischen Patienten ist die Infusionsrate auf 1/3 der Erhaltung + Urinproduktion zu vermindern.
Diuretka erleichtern das Management
Beim oligurischen und anurischen AKI ist es vorteilhaft, die Urinproduktion anzuregen. Falls dies mit Infusionstherapie allein nicht möglich ist, können Diuretika wie Mannitol, Furosemid und Dopamin verwendet werden. Mannitol erhöht den renalen Blutfluss aufgrund seines intravaskulären osmotischen Effektes, vermindert Zellschwellung, erhöht den intratubulären Druck und hilft somit Zelldetritus und Zylinder auszuschwemmen. Zusätzlich wird Mannitol ein antioxidativer Effekt nachgesagt. Es sollte nur nach erfolgter Rehydratation angewandt werden. Bei ausbleibender Diurese nach einem Bolus sollte keine weitere Applikation erfolgen. Schleifendiuretika wie Furosemid steigern den renalen Blutfluss, das Urinvolumen und bewirken eine Kalium- und Kalziumdiurese ohne Steigerung der glomerulären Filtrationsrate (GFR). Dopamin führt in niedrigen Dosen zur Verbesserung der Nierenperfusion. Dieser Effekt ist speziell bei hypotensiven, jedoch nicht sicher bei normotensiven Tieren zu beobachten.
Korrektur weiterer Abweichungen – verbessert das Allgemeinbefinden und die Überlebenschance
Hyperkalämie wird häufig bei anurischen oder oligurischen Nierenerkrankungen beobachtet. Eine Hyperkalämie unter 6 mmol/L sollte mit kaliumfreier Vollelektrolytlösung behandelt werden. Kaliumwerte von 6 – 8 mmol/L können durch den Einsatz von Furosemid gesenkt werden. Die Applikation von Bikarbonat 1 – 2 mmol/kg über 20 min kann helfen, das Kalium von extrazellulär nach intrazellulär zu verschieben. Auch der Einsatz von 1,5 g/kg Glukose als 20 %ige Lösung i.v. und 0.1 – 0.25 I.U. Insulin pro 1 – 2 g Glukose fördert den Kaliumtransport nach intrazellulär. Um die kardialen Effekte der Hyperkaliämie (Kalium > 8 mmol/L) zu kontrollieren, können 0,5 – 1 mL/kg 10 %iges Kalziumglukonat über 10 – 15 min unter EKG-Kontrolle infundiert werden.
Die oft vorhandene metabolische Azidose sollte mit elektrolytangepasster Infusionstherapie therapiert werden. Acetatund malatgepufferte Lösungen scheinen effektiver zu seinen als auf Laktat basierende Lösungen. Der Einsatz von Bikarbonat wird zurzeit stark diskutiert. Die Urämiesymptome wie Vomitus und gastrointestinale Ulzera sollten mit Antiemetika (Maropitant, Metoclopramid, Ondansetron), H2-Rezeptorantagonisten (Cimetidin, Famotidin, Ranitidin) oder Protonenpumpenhemmern (Omeprazol) behandelt werden. Die katabole Stoffwechsellage sollte so schnell wie möglich behandelt werden. Falls die Patienten nicht erbrechen, ist eine sehr energiereiche Diät gegebenenfalls über Ernährungssonden zu verabreichten. Bei Patienten mit Vomitus sollte eine partielle oder totale parenterale Ernährung über einen zentralen Venenkatheter in Betracht gezogen werden.
Blutreinigungsverfahren
Bei ausbleibender Besserung trotz intensiver medikamentöser und Infusionstherapie können die Urämietoxine und somit die Urämiesymptome mithilfe der Blutreinigungsverfahren Peritonealdialyse (PD) und Hämodialyse (HD) reduziert werden. Eine Dialyse wird bei akuten Nierenschädigungen mit Harnstoffwerten über 30 mmol/L, Kreatininwerte über 660 ?mol/L und gleichzeitiger erfolgloser Behandlung mit konventionellen Methoden empfohlen. Kleinmolekulare, ungebundene Toxine wie Ethylenglykol, Ethanol und Gentamicin, aber auch Wasser können ebenso mit der Dialyse entzogen werden.
Einfach durchzuführen – die Peritonealdialyse
Während der Peritonealdialyse wird über einen Katheter Dialysat ins Abdomen eingebracht und nach einer Einwirkzeit wieder abgelassen. Dieser Zyklus wird bis zur Stabilisierung der Nierenwerte wiederholt. Für eine Kurzzeitdialyse können Thoraxdrainagen oder zentralvenöse Katheter transkutan ins Abdomen eingebracht werden. Langzeitkatheter sind chirurgisch zu platzieren. Als Dialysat können kommerzielle Dialyselösungen oder auf NaCl 0.9 % oder Ringer Lösung basierte Lösungen mit Glukosezusatz verwendet werden. Die PD ist weniger effektiv und deutlich zeitaufwändiger als die Hämodialyse, muss unter sterilen Bedingungen durchgeführt werden aber benötigt einen geringeren technischen und finanziellen Aufwand.
Schnell und effektiv – die Hämodialyse
Während der Hämodialyse wird über einen großlumigen Katheter Blut aus dem Patienten entnommen, über eine semipermeable Membran im Dialysator in Kontakt mit dem Dialysat gebracht und nachfolgend dem Patienten zurückgegeben. Das Blut wird dem Patienten über einen in der V. jugularis platzierten großlumigen Doppellumenkatheter entzogen und über ein Schlauchsystem zur Maschine gepumpt. Im Dialysator findet der Kontakt zwischen Blut und Dialysat statt. Die Toxine werden über Diffusion in das Dialysat übertragen und abtransportiert. Das Dialysat kann den Patientenanforderungen in Natrium, Kalium, Kalzium, Glukose, Bikarbonat und Temperatur angepasst werden. Um einer Blutgerinnung im Schlauchsystem vorzubeugen, wird die Blutgerinnung mit kontinuierlicher Heparinapplikation gehemmt. Initial wird für 2 – 3 Tage eine Behandlung pro Tag über 2 – 3 Stunden durchgeführt. In den folgenden Tagen wird alle 2 – 3 Tage eine Behandlung über 4 – 5 Stunden bis zum Wiedereinsetzen der Nierenfunktion vorgenommen. Zur HD sind kostenintensive Geräte und Verbrauchsmaterialien und speziell geschultes Personal notwendig. Daher ist die HD nur in einigen spezialisierten Kliniken verfügbar. Die Überlebensrate der Dialysepatienten beträgt zwischen 30 und 60 % und ist stark von der Ursache des Nierenversagens abhängig. Beim akuten infektiösen Nierenversagen ist sie mit 60 – 85 % am höchsten.
rene.doerfelt@vetmeduni.ac.at
Foto: © Stephanie Horrocks, istockphoto.com
|